Kapazitätsplanung Architekten – Ressourcen im ERP-System steuern
- Bernhard Adler

- 7. Okt. 2025
- 6 Min. Lesezeit
Effiziente Kapazitätsplanung ist das Rückgrat erfolgreicher Architekturbüros – und gewinnt mit wachsender Projektvielfalt und steigenden Anforderungen immer mehr an Bedeutung. Gerade wenn mehrere Deadlines gleichzeitig drängen, Teammitglieder kurzfristig ausfallen und spontane Zusatzaufgaben wie Wettbewerbe ins Haus stehen, entscheidet der Überblick über Ressourcen und Auslastung über Projekterfolg, Termintreue und Teamzufriedenheit.
Ein modernes ERP-System mit integriertem Kapazitätsplanungsmodul schafft genau diese Transparenz: Es vernetzt alle relevanten Informationen, macht Engpässe frühzeitig sichtbar und unterstützt Führungskräfte dabei, Aufgaben flexibel und vorausschauend zu verteilen, was die Kapazitätsplanung erheblich erleichtert. So wird aus komplexer Projektarbeit ein planbarer Prozess – und aus Unsicherheit ein Gefühl von Kontrolle und Gestaltungsfreiheit.
Bedeutung der Kapazitätsplanung für Architekten
Planungssicherheit: Verlässliche Aussagen zu Terminen und Budgets beruhen auf realistischer Auslastung, die im ERP-System zentral abgebildet wird.
Qualität: Konzentration statt Multitasking-Marathon. Je besser Aufgaben im System verteilt sind, desto höher die Planungsqualität.
Zufriedenheit: Überlastung kostet Kreativität. Klare Kapazitätsbilder im ERP schützen Teams vor Burnout.
Wirtschaftlichkeit: Auslastung ist der Hebel für Deckungsbeiträge. Leerläufe und Überstunden lassen sich systematisch steuern.
Typischer Projektworkflow und wo Engpässe entstehen
Architekturprojekte folgen meist einem klaren Ablauf, mit unterschiedlichen Lastspitzen:
Wettbewerbe und Akquise
Grundlagenermittlung und Vorplanung
Entwurfsplanung
Genehmigungsplanung
Ausführungsplanung
Ausschreibung und Vergabe
Objektüberwachung/Bauleitung
Jede Phase verlangt andere Profile. Entwurfsstarke Kolleginnen brauchen Zeitblöcke ohne Meetings. Für Genehmigungen sind Detail- und Normensicherheit gefragt. In der Ausführung bindet die Baustelle Personal mit hohem Anteil an Vor-Ort-Terminen. Genau diese Verschiebungen verursachen Engpässe, oft verschärft durch Urlaubszeiten, Krankheit oder externe Abhängigkeiten – alles Faktoren, die im ERP-Modul Kapazitätsplanung sichtbar und steuerbar werden.
Was eine moderne Kapazitätsplanung im ERP-System leisten sollte
Ein gutes ERP-Modul für Kapazitätsplanung schafft Sichtbarkeit, vereinfacht Entscheidungen und bleibt flexibel. Drei Dinge zählen besonders: eine visuelle Oberfläche, smarte Automatismen und verlässliche Daten aus angrenzenden Modulen wie HR, Projektmanagement und Zeiterfassung.
Visuelle Planung mit Planungsbalken
Zeitachsen mit frei definierbaren Intervallen: Tage, Wochen, Monate, Quartale.
Planung auf Projekt- und Tätigkeitsniveau: vom Paket “LP3 Entwurf Fassade” bis zur “Baubesprechung Los 3”.
Blockplanungen pro Ressource: ganze Tage, halbe Tage, stundenweise Zuweisungen.
Abhängigkeiten und Meilensteine: Verschiebungen werden im System sichtbar und können schnell manuell angepasst werden.
Mitarbeiter- und projektbezogene Ansichten
Wer arbeitet wann an welchem Projekt und welcher Tätigkeit? Alles zentral im ERP einsehbar.
Ressourcen lassen sich projekt- und tätigkeitsbezogen darstellen, sodass Verantwortliche die richtige Sicht für ihre Planung wählen können.
Die Auslastung wird in der grafischen Planung direkt sichtbar – Überlastungen oder freie Kapazitäten erkennt man auf einen Blick.
Planungsansichten können je nach Bedarf geteilt und freigegeben werden – von der detaillierten Tätigkeitssicht bis hin zu Projektübersichten.
Abwesenheiten nahtlos eingebunden
Urlaub, Krankheit, Zeitausgleich werden automatisch aus dem HR-Modul übernommen.
Genehmigte Abwesenheiten sind verbindlich, geplante Abwesenheiten reservieren Kapazität.
Feiertage und Abwesenheiten sind in der Planung berücksichtigt.
Abwesenheiten wie Urlaub oder Krankheit werden automatisch übernommen, sodass Kapazitätslücken rechtzeitig erkennbar sind.
Funktionen für Steuerung und Monitoring im ERP-System
Bei Kapazitäten gilt: planen, prüfen, nachjustieren. Effektives Kapazitätsmanagement mit Komfortfunktionen im ERP spart dabei Zeit.
Drag & Drop: Aufgaben verschieben, verlängern, verkürzen, neue Blöcke anlegen.
Kopieren & Einfügen: wiederkehrende Muster duplizieren, etwa wöchentliche Baubesprechung.
Gruppieren: Aufgaben bündeln, zum Beispiel alle “LP5-Ausführungsdetails” eines Projekts.
Sperren: kritische Blöcke fixieren, damit sie nicht zufällig verschoben werden.
Visuelle Hervorhebungen
Überlastungen: rote Marker ab 100 Prozent, gelb bei drohendem Engpass, grün für Reserven.
Interne vs. externe Tätigkeiten: interne Büroaufgaben getrennt von projektbezogener Arbeit.
Abwesenheiten: klarer Unterschied zwischen genehmigt und geplant.
Konflikte: gleiche Person doppelt verplant, Kollisionen mit Meilensteinen, fehlende Rollenabdeckung.
Smarte Reports mit Soll-Ist-Vergleich
Planwerte vs. tatsächlich erfasste Zeiten pro Phase, Rolle, Person.
Forecast bis zum Projektende auf Basis aktueller Trends.
KPI-Sets: Auslastungsquote, Planerfüllungsgrad, Anteil abrechenbarer Stunden, Anteil externer Leistungen.
Drill-down vom Portfolio bis zur Tätigkeit.
Kollaboration und Zugriff, der zum Architekten-Alltag passt
Transparenz wirkt nur, wenn sie im Team ankommt – und das ERP-System unterstützt dies optimal.
Freigabe und Teilen
Planungsansichten als Links oder Dashboards teilen.
Lese- und Bearbeitungsrechte differenziert vergeben.
Versionierung: Planstände vergleichen, Änderungen dokumentieren.
Mobile App Zugriff
Android, iOS, iPadOS, macOS und Browser: Zugriff auf aktuelle Planung überall.
Schnellaktionen: Tagesplanung checken, Blöcke verschieben, Abwesenheit beantragen.
Benachrichtigungen über Änderungen erfolgen innerhalb der App.
Besonderheiten für Architekturbüros: von HOAI bis Subunternehmer
Die HOAI macht die Struktur eines Projekts greifbar. Sie eignet sich hervorragend als Rückgrat des Ressourcenmanagement und der Ressourcenplanung im ERP-System.
Einbindung von Leistungsphasen
Entwurfsphase (LP3): höhere Kreativlast, weniger Meetings, sorgfältige Fokuszeiten einplanen.
Genehmigungsplanung (LP4): Taktung mit Behördenfristen, Puffer für Rückfragen.
Ausführungsplanung (LP5): hohe Detailtiefe, verlässliche Tagesblöcke, enge Koordination mit Fachplanern.
Ausschreibung/Vergabe (LP6-7): Spitzen rund um Submissionen, gut planbar, aber oft zeitkritisch.
Objektüberwachung (LP8): Präsenz auf der Baustelle, wetter- und lieferkettenabhängig, flexible Slot-Reservierung nötig.
Tipp: Ordnen Sie Aufgaben direkt den HOAI-Phasen zu. So lassen sich Reportings nach LP gruppieren, was die Nachkalkulation und zukünftige Aufwandsschätzungen massiv verbessert.
Externe Partner und Subunternehmer
Projekte und Tätigkeiten lassen sich im System kosten- und ressourcenbezogen planen – auch mit Blick auf den Einsatz externer Leistungen.
Externe Leistungen können in den Projekt- und Kostenplänen berücksichtigt werden.
Projektunterlagen und -informationen lassen sich in Biquanda zentral verwalten und den Projekten zuordnen.
Vertragsmeilensteine in die Zeitachse: Zahlungen, Liefertermine, Prüfzyklen.
Umgang mit kurzfristigen Änderungen
Architektur ist dynamisch. Bauherrenentscheidungen, Lieferengpässe, neue Normen, unklare Bestandslagen.
Die Kapazitätsplanung kann jederzeit flexibel angepasst werden, um auf Änderungen in Projekten zu reagieren.
Planungen können kurzfristig detailliert und langfristig grob gehalten werden – die Detailtiefe passt sich dem Projektverlauf an.
Puffer-Logik: klare Regeln, welche Puffer für welche Phasen gelten.
Eskalationspfade: wenn rot, wer entscheidet was bis wann?
Praxisnahe Tipps für die Tagessteuerung in Architekturbüros
10-Minuten-Slot am Morgen: Team checkt die Auslastung und verschiebt, wenn nötig.
Mittwochs-Check: Projektleiterin gleicht Plan/Ist ab, aktualisiert den Forecast.
Fokusblöcke nicht zerstückeln: Entwurfsarbeit in 2- bis 4-Stunden-Blöcken.
Baubesprechungen bündeln: feste Wochentage reduzieren Kontextwechsel.
Urlaubsplanung halbjährlich synchronisieren: Kapazitätsgipfel früh erkennen.
Krankheitsfälle: Standardregeln für Vertretung und Prioritätenliste bereit halten.
Ein Beispiel aus der Praxis
Ein Büro plant die Sanierung eines Innenstadtquartiers, Bauzeit 18 Monate. Im Sommer starten LP5-Details, parallel laufen Genehmigungsnachträge, im Herbst folgen Vergaben. Zwei Teammitglieder sind wöchentlich auf der Baustelle, eine Kollegin in Elternzeit, ein externer TGA-Planer liefert in Wellen.
Im ERP-Modul werden LP5-Pakete als Tätigkeiten pro Bauteil angelegt.
Baustellenpräsenz geblockt: Dienstag und Donnerstag vor Ort, halbe Tage für Nachbereitung.
Der TGA-Planer erhält fixierte Slots für Modellabgaben. Verzögert sich ein Paket, verschieben sich abhängige Detailblöcke automatisch und färben Kapazitätskonflikte rot.
Nach zwei Wochen zeigt der Ist-Aufwand, dass Fassadendetails 25 Prozent mehr Zeit benötigen. Der Forecast passt die nächsten vier Wochen an, die Genehmigungsnachträge bekommen eine priorisierte Bearbeitung, externe Unterstützung wird für zwei Wochen zugekauft.
Ergebnis: keine Mehrstundenorgie, aber eine saubere, transparente Anpassung mit Abnahme der kritischen Pfade.
So verbinden Sie Planung mit Controlling
Kapazität ist die Brücke zwischen Zeit und Geld. Wenn Planwerte sauber im ERP gepflegt sind, wird das Projektcontrolling zum Partner statt zum Mahner.
Stundenrückmeldung ist kein Selbstzweck: Sie verbessert die nächste Schätzung.
Earned-Value-Logik im Kleinen: Fortschritt je Tätigkeit vs. verbrauchte Stunden.
Budgetampel pro Phase: grün bis 85 Prozent, gelb bis 100 Prozent, rot ab 101 Prozent.
Claim-Management stützen: dokumentierte Verschiebungen und Begründungen helfen bei Nachträgen.
Einrichten, aber richtig: Vorgehensweise für den Start
Rollen und Skill-Matrix im ERP definieren: wer kann was, wie viel Prozent der Zeit.
Projekte in Phasen schneiden: HOAI als Struktur übernehmen, Tätigkeiten konkret benennen.
Abwesenheiten importieren: Urlaubspläne, Feiertage, Teilzeit.
Planungsregeln formulieren: Mindestblockgröße, Puffer pro Phase, Vertretungslogik.
Dashboards aufsetzen: je Ebene eine Ansicht, plus Portfolioübersicht.
Schulung und Rhythmus: kurze, wiederkehrende Planungsroutinen etablieren.
Feinheiten, die im Alltag oft den Unterschied machen
Zeitfenster schließen: Ein 6-Stunden-Fokusblock ist wertvoller als drei 2-Stunden-Blöcke.
Kommunikationskorridore: feste Slots für Rückfragen an Fachplaner beschleunigen Entscheidungen.
Standardisierte Pakete: vordefinierte Tätigkeitsbausteine je Phase sparen Zeit und erhöhen die Vergleichbarkeit.
Notfallreserve: 5 bis 10 Prozent Teamzeit ungebunden lassen für Unvorhergesehenes.
Wissensspeicher: Lessons Learned an Tätigkeiten hängen, um die nächste Schätzung zu verbessern.
Interne vs. externe Tätigkeiten bewusst steuern
Nicht jede Stunde ist projektbezogen. Interne Aufgaben sind wichtig, aber sie müssen sichtbar bleiben.
Büroadministration, Wettbewerbe, Fortbildung, BIM-Standards, Qualitätssicherung.
Klare Kontingente pro Woche, getrennt ausgewiesen.
Saisonale Schwankungen beachten, etwa Jahresabschluss oder Zertifizierungsaudits.
Rechte, Rollen, Vertrauen
Transparenz braucht Grenzen und Fairness.
Jeder sieht, was er braucht: Teamleitung mehr Details, Einzelne nur ihre Planung.
Keine Micromanagement-Falle: Kapazität planen, nicht jede Minute.
Offene Kultur: Engpässe früh melden ist gewünscht, nicht peinlich.
Typische Stolpersteine und einfache Gegenmittel
Zu grobe Planung: führt zu Scheinpräzision. Besser: Tätigkeiten konkret benennen.
Zu viel Aktualisierung: niemand hat Zeit. Besser: fester Rhythmus, klare Verantwortungen.
Abwesenheiten vergessen: führt zu Dopplungen. Besser: HR-Sync nutzen, Genehmigungen automatisiert einlesen.
Externe Kapazität überschätzt: Verträge mit Meilensteinen und echten Zusagen absichern.
Ein Wort zur Kultur der Planbarkeit
Architektur lebt von Ideen. Strategische Kapazitätsplanung im ERP-System ist kein Käfig, sondern das Gerüst, das kreative Arbeit trägt. Wer sein Team vor planbare Überlast schützt, hält den Kopf frei für die Lösung schwieriger Entwurfsfragen. Wer pünktlich liefert, schafft Vertrauen beim Bauherrn und Spielräume im Budget.
Nächste Schritte für den Einsatz im Büro
Pilotprojekt wählen: mittelgroß, vollständiger Phasenmix, klare Meilensteine.
Drei Standardansichten bauen: Team, Projekt, Portfolio.
Zwei KPIs definieren, die ab Woche eins gemessen werden.
Regeln schriftlich festhalten: Puffer, Blockgrößen, Update-Rhythmus.
Nach vier Wochen Retrospektive: was funktioniert, was wird angepasst.
Checkliste für den Wochenstart
Sind alle Abwesenheiten für die nächsten sechs Wochen im System?
Welche Projekte haben kritische Pfade mit roter Markierung?
Wo gibt es freie Kapazität, die auf wichtige Aufgaben verschoben werden kann?
Welche externen Lieferungen stehen an und sind kapazitiv abgesichert?
Wurde der Plan/Ist-Abgleich aktualisiert und an die Teamleitung kommuniziert?
Wenn Planung zur Gewohnheit wird und das ERP-System als zentrales Steuerungsinstrument genutzt wird, entsteht ein stabiles Fundament: klare Aufgaben, realistische Zeitfenster, belastbare Forecasts. Daraus wachsen Qualität, Termintreue und Gelassenheit. Genau das, was Architekturteams brauchen, um ihre Ideen sicher zu bauen.
Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie unverbindlich unsere Demo oder
nutzen Sie Biquanda im vollen Umfang kostenlos für bis zu 4 Mitarbeiter.
.png)



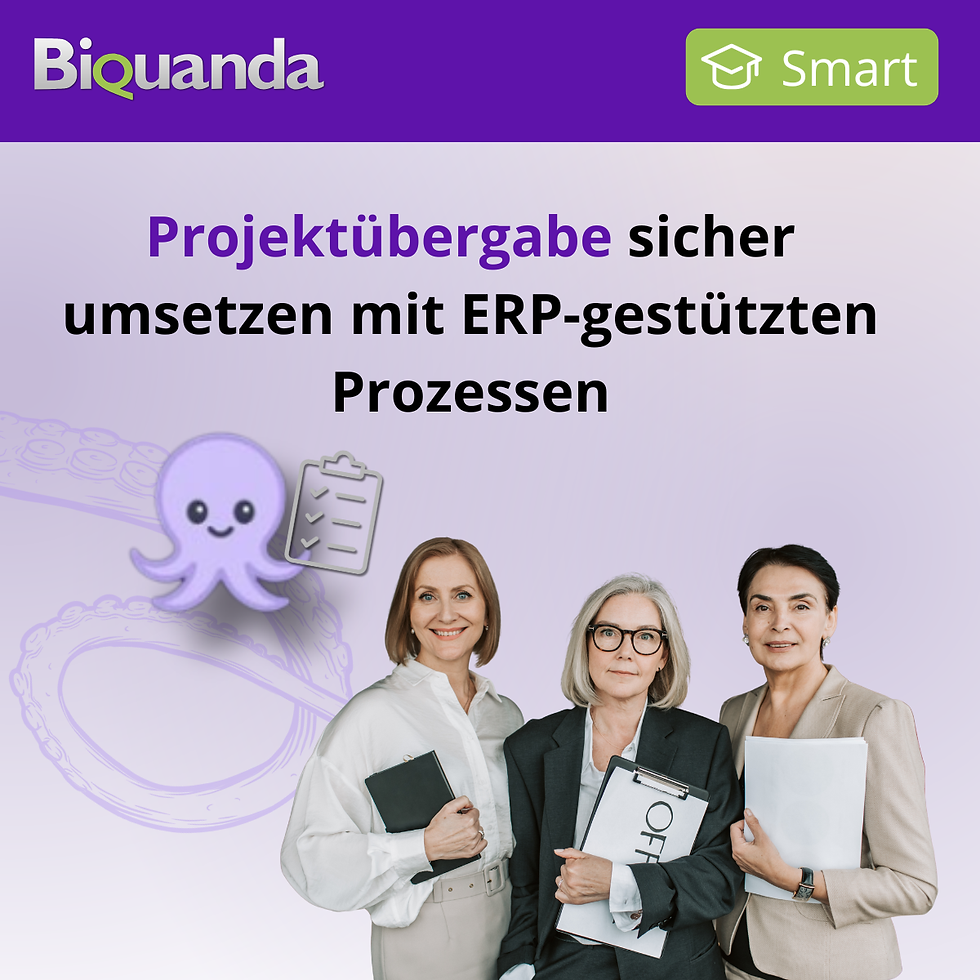

Kommentare